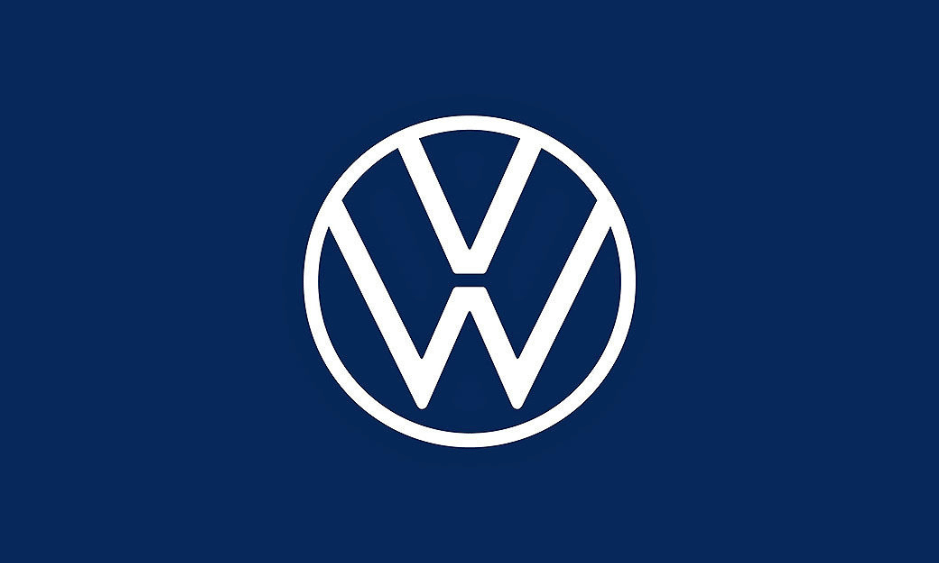Wem gehört Volkswagen?
- Vor 6 Monaten veröffentlicht
Chronologische Zusammenfassung
- 1937: Gründung der Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH in Wolfsburg.
- 1945: Nachkriegszeit: Übernahme durch die britische Militärregierung, Wiederaufbau der Produktionsstätte.
- 1960: Börsengang der Volkswagen AG, erste Aktien werden öffentlich gehandelt.
- 2007: Übernahme der Mehrheit der Aktien durch die Porsche Automobil Holding SE.
- 2012: Gründung der Porsche Automobil Holding SE als Muttergesellschaft von Volkswagen.
- 2015: Staatliche Holding Niedersachsen erhöht ihren Aktienanteil auf 20%.
- 2022: Oliver Blume wird zum CEO von Volkswagen ernannt.
- 2024: Porsche Automobil Holding SE hält weiterhin die Mehrheit der Anteile an Volkswagen AG.
- 2025: Aktuelle Eigentümerstruktur: Porsche Automobil Holding SE (~53%), Staatliche Holding Niedersachsen GmbH (~20%), institutionelle Investoren und private Aktionäre (~27%).
Volkswagen, häufig kurz als VW bezeichnet, ist weit mehr als nur ein traditionsreicher Automobilhersteller. Die Volkswagen AG hat sich über die Jahrzehnte zu einem global agierenden Konzern entwickelt, der zahlreiche Marken unter seinem Dach vereint – darunter Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania und MAN. Der Begriff „Volkswagen“ ist längst nicht nur synonym für den berühmten Käfer oder den modernen Golf. Vielmehr steht der Name für eines der wichtigsten Unternehmen der deutschen Wirtschaft und ist ein Aushängeschild für Ingenieurskunst und technologische Innovation in der Automobilbranche.
Wer sich allerdings mit der Frage „Wem gehört Volkswagen?“ beschäftigt, stößt rasch auf eine komplexe Antwort. Die Eigentumsstrukturen basieren auf dem Volkswagen-Gesetz, verschiedenen Anteilseignergruppen und einem außergewöhnlichen Zusammenspiel von Familienbeteiligungen, staatlichen Einflüssen und global agierenden Investmentfonds. Dies spiegelt nicht nur die bewegte Firmengeschichte wider, sondern zeigt auch die dynamischen Veränderungen in der Automobilindustrie insgesamt.
Dieser Artikel beleuchtet die historischen Wurzeln und die Entwicklung des Volkswagen-Konzerns, wirft einen Blick auf die Gründerpersönlichkeiten, beschreibt die heutige Führungsriege und erörtert umfassend die aktuelle Eigentumsverteilung. Gerade angesichts wachsender Herausforderungen durch Elektromobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte lohnt es sich, genauer hinzusehen, wie und von wem der Volkswagen-Konzern gesteuert wird. Im Folgenden erfahren Sie alle relevanten Details zu Gründung, Gründern, Management, Umsatz sowie den größten Anteilseignern und welche Rolle diese Gruppen bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen.
Seit wann gibt es das Unternehmen?
Die Gründung des heutigen Volkswagen-Konzerns geht auf das Jahr 1937 zurück. Genau genommen entstand damals die „Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“, die ursprünglich den Auftrag erhielt, ein „Volks-Auto“ zu entwickeln – ein kostengünstiges Fahrzeug für die breite Bevölkerung. Dieser geschichtliche Kontext ist eng mit den nationalsozialistischen Machthabern verknüpft, die über das sogenannte „Kraft-durch-Freude“-Programm (KdF) den „KdF-Wagen“ propagierten. 1938 erfolgte dann die Umbenennung in „Volkswagenwerk GmbH“. Obwohl das Unternehmen in dieser Zeit stark in die Kriegswirtschaft eingebunden wurde, bildet diese Phase dennoch den offiziellen Startpunkt der Marke Volkswagen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die britische Militärverwaltung die Kontrolle über das Volkswagenwerk. Weil das Werk weitgehend intakt geblieben war, entschied man, die Produktion des ursprünglichen Käfer-Modells (damals noch als VW Typ 1 bekannt) wieder aufzunehmen, um damit die deutsche Bevölkerung mit günstigen Fahrzeugen zu versorgen. Die Briten machten es sich zur Aufgabe, den Betrieb wirtschaftlich zu stabilisieren und das Fundament für ein wiedererstarkendes Unternehmen zu legen. Schon ab 1949 war das Land Niedersachsen Mehrheitseigner, was die Zukunft des Unternehmens maßgeblich prägte und zur Grundlage des sogenannten „Volkswagen-Gesetzes“ wurde, das Niedersachsen eine Sperrminorität und besondere Mitspracherechte sicherte.
Die eigentliche Erfolgsgeschichte von VW begann, als man den Käfer zum weltweiten Exportschlager machte. Das relativ einfache, aber zuverlässige Modell erfreute sich insbesondere in den Nachkriegsjahren großer Beliebtheit. Auch nach Umwandlung in eine Aktiengesellschaft (Volkswagen AG) im Jahr 1960 standen Wachstum und Internationalisierung im Vordergrund. Die Entscheidung, weitere Marken zu übernehmen, erwies sich langfristig als strategischer Meilenstein. So entwickelte sich aus einer kleinen Gesellschaft zur Vorbereitung eines „Volkswagens“ Schritt für Schritt ein globaler Multimarken-Konzern, der heute zu den umsatzstärksten Unternehmen im Automobilsektor weltweit zählt.
Wer ist der Gründer?
Wenn von der Gründung Volkswagen gesprochen wird, stellt sich oft die Frage, ob Ferdinand Porsche oder das NS-Regime als Gründer bezeichnet werden kann. Tatsächlich ist die Geschichte komplex: Formal war die „Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“ eine staatlich initiierte Institution, gegründet durch das NS-Regime, das den Auftrag für ein Volksauto an Ferdinand Porsche vergab. Porsche war bereits ein angesehener Automobilkonstrukteur, der für diverse Marken – darunter Daimler, Wanderer und Auto Union – tätig gewesen war. Aus Sicht der Technikgeschichte gilt Porsche als „Vater“ des KdF-Wagens, der später unter dem Namen VW Käfer berühmt wurde.
Ferdinand Porsche selbst wurde 1875 in Maffersdorf (heute in Tschechien) geboren. Er besaß eine ausgeprägte technische Begabung und begann seine Karriere bei der Jacob Lohner & Co. in Wien, wo er Elektrofahrzeuge entwickelte. Später wechselte er zu Daimler und war in der Entwicklung von hochmodernen Fahrzeug- und Motorenkonzepten tätig. Seine eigene Konstrukteursfirma, das Konstruktionsbüro Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH, gründete er 1931 in Stuttgart. Hier entwickelte er im Auftrag unterschiedliche Automobilkonzepte, darunter den späteren „KdF-Wagen“.
Allerdings ist die Gründungsgeschichte durch die Verstrickung in das nationalsozialistische Regime hochsensibel. Adolf Hitler persönlich setzte sich für den Bau eines günstigen Volkswagens als Propagandaprojekt ein. Letztendlich agierte Ferdinand Porsche in dieser Phase als technischer Leiter und Chefkonstrukteur für das Vorhaben. Nach dem Krieg geriet Porsche aufgrund seiner Tätigkeit für das Regime in französische Kriegsgefangenschaft und kehrte erst danach wieder ins Automobilgeschäft zurück, unter anderem mit der 1948 eingeführten Porsche-Sportwagenlinie.
Dennoch kann man in technischer Hinsicht Ferdinand Porsche als den maßgeblichen Wegbereiter des ersten Serienmodells von Volkswagen betrachten, auch wenn die formale Unternehmensgründung durch staatliche Strukturen der NS-Zeit erfolgte. Letzteres erklärt, warum VW heute häufig offiziell vom „Staat“ als ursächlichem Gründer spricht, während Porsche als geistiger Vater der wichtigsten Konstruktion gilt.
Wer ist der aktuelle CEO?
Der heutige Volkswagen-Konzern wird von Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem (CEO) geleitet. Er trat die Nachfolge von Herbert Diess an und übernahm zum 1. September 2022 offiziell die Führungsspitze der Volkswagen AG. Zuvor war Oliver Blume Vorsitzender des Vorstands bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, einer wichtigen Tochtergesellschaft von Volkswagen. Seine gleichzeitige Rolle als Porsche-Chef hat er zunächst beibehalten, was im Konzern zu einer Doppelbelastung, aber auch zu Synergieeffekten führen kann.
Oliver Blume, geboren 1968 in Braunschweig, ist schon lange im Volkswagen-Konzern tätig. Er begann seine Karriere bei Audi und übernahm später verschiedene Führungsaufgaben bei SEAT sowie Volkswagen. Mit der Zeit avancierte er bei Porsche zunächst zum Produktionsvorstand und schließlich zum CEO. Unter seiner Führung konnte Porsche auch in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten konstante Wachstumsraten vorweisen und sich strategisch für die Herausforderungen der Elektromobilität wappnen. So trug er maßgeblich zur Entwicklung des Taycan bei, dem ersten vollelektrischen Sportwagen von Porsche.
Als neuer Konzernlenker hat Blume eine zentrale Aufgabe: die Transformation von Volkswagen hin zu Elektrofahrzeugen, Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen konsequent voranzutreiben. Intern wird auf eine stärkere Abstimmung zwischen den verschiedenen Marken gesetzt, um Technologien effizient zu nutzen und Entwicklungsressourcen zu bündeln. Zugleich sieht er die Notwendigkeit, den internationalen Wettbewerb gegen starke Konkurrenten wie Tesla, Toyota und verschiedene chinesische Anbieter anzunehmen.
Eine der wesentlichen Herausforderungen für Blume ist es zudem, die Effizienzprogramme innerhalb des Konzerns zu forcieren und den strategischen Umbau der Produktions- und Lieferketten abzusichern. In seiner Rolle als CEO muss er auch den Erwartungen der verschiedenen Anteilseignergruppen gerecht werden – von den Familien Piëch und Porsche über das Land Niedersachsen bis hin zu institutionellen Investoren wie dem Staatsfonds von Katar. Darüber hinaus ist er gefordert, die Reputation des Konzerns nach dem Diesel-Skandal weiter zu verbessern und Vertrauen in die neuen Technologien aufzubauen.
So viel Umsatz macht das Unternehmen
Die Volkswagen AG zählt zu den umsatzstärksten Automobilkonzernen der Welt. Laut den jüngsten Geschäftsberichten (basierend auf den jeweils aktuell verfügbaren Informationen) generiert das Unternehmen regelmäßig Umsätze in dreistelliger Milliardenhöhe. Dabei spielen nicht nur die Kernmarke Volkswagen Pkw, sondern insbesondere auch die anderen Konzernmarken eine entscheidende Rolle. Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Audi, ŠKODA, SEAT, Porsche sowie die Sparte Volkswagen Nutzfahrzeuge. Marken wie Bentley, Lamborghini und Bugatti, die zum Luxus- beziehungsweise Supersportwagensegment gehören, tragen zwar in absoluten Zahlen etwas weniger zum Konzernumsatz bei, dienen jedoch als Imageträger und sichern hohe Margen.
Die Entwicklung des Konzernumsatzes in den letzten Jahren zeigt trotz der Turbulenzen rund um den Diesel-Skandal und die globale COVID-19-Pandemie eine bemerkenswerte Robustheit. Dabei kam dem Volkswagen-Konzern zugute, dass er mit seiner breiten Palette an Marken in unterschiedlichen Preissegmenten vertreten ist und somit sowohl Mainstream-Kunden als auch Premium- und Luxusklientel bedient. Parallel dazu konnte man durch die langjährige Präsenz in internationalen Märkten – vor allem in China – Schwankungen teilweise ausgleichen.
Besonders erwähnenswert ist das beständige Wachstum von Porsche, einer der rentabelsten Marken im Portfolio. Die Profitabilität im Premiumsegment hilft, die oft hohen Entwicklungs- und Investitionskosten für neue Technologien im Gesamtkonzern zu finanzieren. Außerdem fließen beträchtliche Summen in die Forschung und Entwicklung zur Elektromobilität: Volkswagen hat in jüngster Zeit hohe Beträge in die Entwicklung von Elektroautos und Batterietechnologien investiert. Dieses Engagement ist für den künftigen Erfolg entscheidend, da weltweit immer strengere CO₂-Grenzwerte und eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen den Markt verändern.
Unterm Strich verfügt die Volkswagen AG damit über eine enorme finanzielle Schlagkraft. Der Konzernumsatz ist ein aussagekräftiger Indikator für die globale Positionierung und das Vertrauen von Käufern und Investoren. Damit bleibt VW ein bedeutender Akteur auf dem internationalen Automobilmarkt.
So verlief die unternehmerische Erfolgsgeschichte
Die unternehmerische Erfolgsgeschichte von Volkswagen begann bereits mit dem VW Käfer, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders aufstieg. Der robuste, zuverlässige und vergleichsweise erschwingliche Wagen fand Millionen Abnehmer weltweit. In den 1950er-Jahren wurde VW zu einem der bekanntesten deutschen Exportunternehmen, und der Käfer avancierte zum echten Kultauto, das in den USA unter dem Spitznamen „Beetle“ große Beliebtheit erlangte.
In den 1960er-Jahren fand der nächste große Schritt statt, als die Volkswagenwerk GmbH 1960 in die Volkswagen AG (Aktiengesellschaft) umgewandelt wurde. Der Börsengang ermöglichte eine Diversifikation der Aktionärsstruktur und eröffnete neue Finanzierungsmöglichkeiten für ambitionierte Wachstumspläne. In der Folge begann Volkswagen, verschiedene Marken zu übernehmen oder neu zu gründen. Einen Meilenstein bildete der Zukauf von Audi (damals Auto Union) in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren, was den Einstieg in das Premiumsegment signalisierte.
Ab den 1980er-Jahren folgten weitere Akquisitionen, wie SEAT in Spanien und ŠKODA in Tschechien. Diese strategischen Erweiterungen stärkten Volkswagens Position im europäischen Markt erheblich. In den 1990er-Jahren kamen mit Bentley, Bugatti und Lamborghini hochklassige Luxus- und Sportmarken hinzu. Der Volkswagen-Konzern entwickelte sich zu einem Multimarken-Imperium, das vom Kleinwagen bis zum Hochleistungssportwagen alles im Portfolio hat.
Der Sprung ins neue Jahrtausend war von technologischen Innovationen, dem Ausbau internationaler Produktionskapazitäten und einer weiteren Umsatzsteigerung geprägt. Auch die Integration der Nutzfahrzeugsparten, einschließlich MAN und Scania, machte den Konzern zu einem der größten Anbieter im Bereich Lkw und Busse.
Trotz des schweren Imageschadens durch den Dieselskandal ab 2015 gelang es Volkswagen, sich erneut zu behaupten. Angesichts steigender Investitionen in Elektroantriebe, Digitalisierung und autonomes Fahren liegt der Fokus nun darauf, sich als Vorreiter der Mobilitätswende zu etablieren. Mit einer breiten Modellpalette und innovativen Technologien will Volkswagen seine Geschichte der Erfolge fortsetzen und den Konzern langfristig neu ausrichten.
Wer hält die größten Anteile am Unternehmen?
Die Frage „Wem gehört Volkswagen?“ lässt sich nicht einfach mit „der Öffentlichkeit“ oder „privaten Investoren“ beantworten. Tatsächlich ist die Eigentümerstruktur der Volkswagen AG äußerst vielschichtig und in einigen Punkten sogar einzigartig. Im Zentrum steht die Porsche Automobil Holding SE (oft kurz „Porsche SE“ genannt), die von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert wird. Diese Holding hält den größten Einzelanteil an der Volkswagen AG. Abhängig von den aktuellen Stimmrechtsanteilen und Meldungen befindet sich das Niveau in einer Größenordnung um die 31 bis 32 Prozent der Stammaktien.
Ein weiterer wichtiger Akteur ist das Land Niedersachsen. Durch das sogenannte Volkswagen-Gesetz genießt Niedersachsen bis heute eine Sperrminorität und hält rund 20 Prozent der Stammaktien. Diese Sperrminorität räumt dem Bundesland wichtige Mitspracherechte ein, insbesondere was weitreichende Entscheidungen über Produktionsstandorte oder Übernahmen angeht.
Neben der Porsche SE und Niedersachsen besitzt auch der Staatsfonds von Katar (Qatar Investment Authority, QIA) einen beachtlichen Anteil. Katar ist mit rund 10 bis 15 Prozent (je nach Quellenstand) der Stammaktien ebenfalls einer der Hauptanteilseigner und spielt in strategischen Fragen sowie bei Kapitalmaßnahmen eine relevante Rolle.
Der übrige Teil der Volkswagen-Aktien – oftmals als „Free Float“ bezeichnet – wird an der Börse gehandelt. Hier finden sich institutionelle Investoren, Fonds und Privatanleger. Die Stammaktien gelten dabei als stimmberechtigte Papiere, während Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht) häufig im Besitz von Investoren sind, die in erster Linie auf Dividendenrendite setzen.
Diese Aufteilung macht deutlich, dass eine zentrale Rolle den Familien Piëch und Porsche zukommt, die über die Porsche SE faktisch das Sagen haben. Niedersachsen und Katar besitzen jedoch erhebliche Einflussmöglichkeiten, was die strategische Ausrichtung angeht. Das Ergebnis ist ein stark von verschiedenen Interessengruppen geprägtes Unternehmen, das aber gerade durch dieses breite Fundament eine gewisse Stabilität genießt.
Fazit
Volkswagen ist heute ein globaler Gigant in der Automobilbranche, der ein riesiges Markenportfolio bedient und zu den weltweit führenden Konzernen bei Umsatz, Absatz und Innovationskraft gehört. Die Geschichte von VW begann 1937 unter staatlicher Kontrolle, als die Nationalsozialisten ein „Volks-Auto“ erschaffen wollten. Technisch umgesetzt wurde dies von Ferdinand Porsche. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm zunächst die britische Militärverwaltung das Werk, bis es 1949 an die deutsche Regierung und das Land Niedersachsen überging. Damit war das Fundament für das Volkswagen-Gesetz gelegt, das bis heute das Mitspracherecht des Bundeslandes Niedersachsen sichert.
Über die Jahrzehnte hinweg wuchs der Konzern stetig, unter anderem durch die Übernahme und Integration zahlreicher Marken – von Audi und SEAT über ŠKODA bis hin zu Luxusmarken wie Bentley und Bugatti. Auch Porsche ist heute fester Bestandteil des Volkswagen-Konzerns, wobei hier eine Besonderheit existiert: Die Porsche Automobil Holding SE, in der die Familien Porsche und Piëch das Sagen haben, ist der größte Einzelaktionär der Volkswagen AG.
Aktuell wird das Unternehmen von Oliver Blume geleitet, der als CEO das Ruder im Zuge der Transformation Richtung Elektromobilität, Digitalisierung und neuer Mobilitätslösungen übernommen hat. Trotz Herausforderungen wie dem Diesel-Skandal und verschärften Umweltvorschriften steht Volkswagen auf soliden finanziellen Füßen. Der Umsatz in dreistelliger Milliardenhöhe zeigt, wie breit und wirtschaftlich solide das Unternehmen im Markt aufgestellt ist.
Der Konzern gehört somit zwar vielen Anteilseignern, doch spielen vor allem die Porsche/Piëch-Familien, das Land Niedersachsen und die Qatar Investment Authority die entscheidenden Rollen. Gerade durch diese Dreiecksstruktur aus Familienbeteiligung, staatlichem Einfluss und internationalem Investment genießt VW eine besondere Form der Stabilität. In Zukunft dürfte der Konzern verstärkt an neuen technologischen Lösungen arbeiten, um auch in einer von Elektroautos und autonomen Fahrfunktionen geprägten Zukunft zu den Branchenführern zu gehören.